
Die Gemeinde Leiblfing ist im Juni 2025 in die kommunale Wärmeplanung gestartet. Ziel ist es, mögliche Pfade zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 aufzuzeigen. Dafür arbeitet die Gemeindeverwaltung mit dem Ingenieurbüro prosio engineering GmbH aus Lauf an der Pegnitz zusammen.
Im Kern des Projektes wird ein maßgeschneidertes Konzept für eine klimafreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung erstellt. Bürgermeister Josef Moll hebt hervor: „Die kommunale Wärmeplanung soll sowohl unseren Bürgerinnen und Bürgern als auch der lokalen Wirtschaft eine verlässliche Orientierung bieten. Dafür sollen ökologisch und finanziell sinnvolle Lösungen gefunden werden.“ Entscheidend für den Erfolg des Vorhabens ist die enge Einbindung aller Beteiligten – von der Bürgerschaft über die Politik, lokale Betriebe, und Landwirtschaft bis hin zur Gemeindeverwaltung.
Während des Prozesses werden alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Leiblfing regelmäßig über entscheidende Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Adrian Heider, Klimaschutzmanager von Leiblfing, unterstreicht: „Wir möchten verständlich kommunizieren und die Öffentlichkeit frühzeitig einbinden. Es folgen mehrere Informationsveranstaltungen und andere Möglichkeiten zur Beteiligung, die rechtzeitig angekündigt werden.“ Für Anfang Oktober 2025 ist ein großer Themenabend mit den Ergebnissen der ersten Untersuchungen und für alle allgemeine Anliegen geplant.
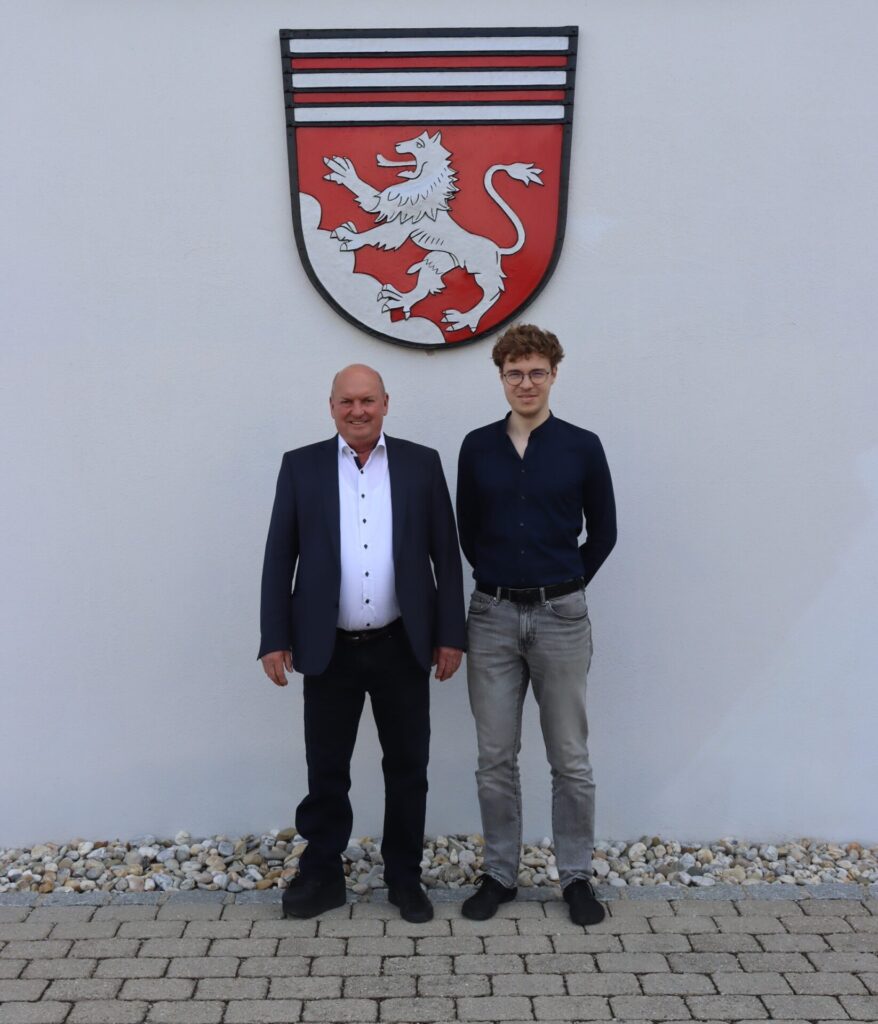
Vier Schritte des Projektes
- Bestandsanalyse: Zunächst werden Gebäudestrukturen, Heizungen und die bestehende Energieversorgung untersucht. Wichtige Fragen lauten: Wo besteht ein hoher Wärmebedarf? Woher stammt die Energie? Welche Netze sind schon vorhanden?
- Potenzialanalyse: Im Anschluss werden alle vor Ort verfügbaren Energiequellen zusammengetragen und jeweils Möglichkeiten für eine künftige Nutzung ermittelt.
- Entwicklung von Szenarien: Gemeinsam mit dem Projektteam werden verschiedene Versorgungsmodelle erstellt und bewertet. Dabei geht es auch um die Frage, wo Wärmenetze sinnvoll sind und wo dezentrale Lösungen bevorzugt werden sollten.
- Umsetzungskonzept: Im letzten Schritt wird ein genauer Fahrplan mit Maßnahmen, Zuständigkeiten und Strategien erstellt. Dieser bildet die Grundlage für die spätere Umsetzung und langfristige Sicherung der Planung.
Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung
Die Fertigstellung des Konzeptes ist für erste Halbjahr 2026 geplant und liegt damit deutlich vor der gesetzlichen Frist Ende Juni 2028. Der Wärmeplan wird vom Gemeinderat beschlossen und im Anschluss veröffentlicht. Darin wird aufgezeigt, welche Gemeindegebiete künftig möglicherweise über zentrale Wärmenetze oder Wasserstoffnetze versorgt werden könnten. An manchen Orten kommen absehbar nur dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen infrage. Dort, wo noch keine abschließende Bewertung möglich ist, werden Prüfgebiete ausgewiesen. In jedem Fall erhalten Gebäudeeigentümer, Netzbetreiber, Energieversorger und alle weiteren Interessensgruppen wertvolle Informationen, um die Planungssicherheit bei der Wahl zukunftsfähiger Heiztechnologien zu erhöhen.
Nachfolgend werden häufige Fragen zur kommunalen Wärmeplanung beantwortet. Außerdem sind auf der Website der Gemeinde Leiblfing hilfreiche Quellen sowie ein ausführliches Informationsangebot zur persönlichen Energieversorgung verfügbar (siehe Förderprogramme und Energieberatung). Für alle weiteren Anliegen erreichen Sie das Klimaschutzmanagement der Gemeinde Leiblfing mit einer E-Mail an klima@leiblfing.bayern.de oder telefonisch unter 09427 / 9503-32.
Was ist die kommunale Wärmeplanung?
Die kommunale Wärmeplanung unterstützt Kommunen dabei, ihre Wärmeversorgung langfristig auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umzustellen. Sie umfasst die Erhebung von Daten, die Analyse des aktuellen Wärmesystems und die Entwicklung von Maßnahmenplänen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen.
Warum ist die kommunale Wärmeplanung wichtig?
Durch die kommunale Wärmeplanung werden den Kommunen Wege zur effizienten Deckung des Wärmebedarfs gezeigt und dabei der Einsatz von erneuerbaren Energien erhöht, um die Klimaziele zu erreichen. Eine systematische Wärmeplanung unterstützt zudem die Planung von Fernwärme, die Nutzung von Abwärme und die Verbesserung der Energieeffizienz.
Was ist das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung?
Die kommunalen Wärmeplanung ist eine langfristige Strategie für das gesamte Gemeindegebiet und beinhaltet einige konkrete Maßnahmen, wie die Wärmewende durch die kommunale Verwaltung unterstützt und vorangetrieben werden kann. Nach Abschluss der Wärmeplanung wird ein Bericht mit allen Ergebnissen veröffentlicht. Damit kann dann die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Maßnahmen (z.B. den Bau von Wärmenetzen) abgeschätzt werden, aber alle weiterführenden Planungen folgen unabhängig von der kommunalen Wärmeplanung.
Ist die kommunale Wärmeplanung gesetzlich vorgeschrieben?
Ja. Das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (WPG) ist zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Dieses Gesetz verpflichtet zur Erstellung und regelt den Inhalt sowie Umfang der kommunalen Wärmeplanung. In Bayern ist die dazugehörige Verordnung am 02. Januar 2025 in Kraft getreten.
Was ist das Ziel des Gesetzgebers (Bund und Land) mit der kommunalen Wärmeplanung?
Wärmeverbraucher und Wärmequellen sollen einheitlich erfasst werden. Ein großer Schwerpunkt liegt auch auf der Ermittlung von Straßen, Quartieren oder Gemeindeteilen mit hohem Wärmebedarf pro Fläche. Solche Gebiete eignen sich häufig für eine zentrale Wärmeversorgung mit Wärmenetzen. Die kommunale Wärmeplanung stellt aber zunächst nur eine grundsätzliche Eignung fest und plant Wärmenetze nicht im Detail.
Wie ist der Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Mit dem zum 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde beschlossen, dass ab diesem Datum jede neu eingebaute Heizung (NICHT bestehende) mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Der Einbau von nur mit fossilen Energieträgern betriebenen Heizungen (z.B. Erdöl und Erdgas) ist also nicht mehr erlaubt. Allerdings hat der Gesetzgeber für Bestandsgebäude eine Übergangsfrist bis 30.06.2028 eingeräumt. Außerdem erfüllt ein Anschluss an ein mit erneuerbaren Energien betriebenes Wärmenetz die Anforderungen des GEG. Nach Abschluss der Wärmeplanung ändern sich möglicherweise die Übergangsfristen für Teile des Gemeindegebiets (Bekanntmachungen folgen).
Wie ist der Stand der kommunalen Wärmeplanung in Leiblfing?
Die Gemeinde Leiblfing ist, wie alle Kommunen, planungsverantwortlich und arbeitet bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung mit der prosio engineering GmbH aus Lauf an der Pegnitz zusammen. Die Arbeiten haben im Juni 2025 begonnen, und mit dem Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung wird im Frühjahr 2026 gerechnet.
Bis wann muss die kommunale Wärmeplanung spätestens vorliegen?
Die Frist ist abhängig von den Einwohnerzahlen der Kommune. In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern muss die kommunale Wärmeplanung bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern gilt der 30. Juni 2028. Für die Gemeinde Leiblfing muss die Wärmeplanung deshalb spätestens bis Mitte 2028 abgeschlossen sein. Allerdings wird das Konzept nach jetztigem Stand deutlich früher finalisiert.
Wie wird die kommunale Wärmeplanung finanziert?
Die Kosten für die kommunale Wärmeplanung trägt zunächst die Kommune selbst. Durch Förderprogramme des Bundes und Zuschüsse der Bundesländer erfolgt allerdings eine in der Regel kostendeckende Finanzierung. Die Gemeinde Leiblfing finanziert die Kommunale Wärmeplanung insbesondere über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundeswirtschaftsministeriums.
Welche Schritte umfasst die kommunale Wärmeplanung?
Die kommunale Wärmeplanung soll einen Fahrplan für Leiblfing erstellen, der den Weg hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufzeigt. Dafür wird in einer Bestandsanalyse zunächst erhoben, wo in Leiblfing aktuell wie viel Wärme benötigt wird und welche Energieträger dafür zum Einsatz kommen. Die Potenzialanalyse deckt anschließend auf, wo erneuerbare Energiequellen in welchem Umfang zur Verfügung stehen. Diese Informationen dienen als Grundlage, um schließlich Szenarien mit konkreten Meilensteinen und Umsetzungsmaßnahmen zu erarbeiten. Es soll gezeigt werden, wie die Wärmewende in den unterschiedlichen Gemeindeteilen von Leiblfing gelingen kann.
Welche Technologien spielen eine Rolle in der kommunalen Wärmeplanung?
Die klimaneutrale Wärmeversorgung kann aus unterschiedlichen (erneuerbaren) Energiequellen erfolgen:
-
- Fernwärme / Nahwärme: Effiziente Verteilung von Wärme über ein Netz, oft aus zentralen Erzeugungsanlagen, die erneuerbare Energien oder Abwärme nutzen
- Wärmepumpen: Nutzung von Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser, Erde) zur effizienten Beheizung von Gebäuden
- Solarthermie: Erzeugung von Wärme aus Sonnenenergie
- Blockheizkraftwerke (BHKW): Kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme („Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK)), zukünftig betrieben mit erneuerbaren Energien
- Stromdirektheizung
- Biomasse: Betrieb z.B. mit Hackschnitzeln oder Holzpellets
- Gasheizung: NUR wenn nachweislich mit erneuerbaren Gasen (Wasserstoff, Biomethan) betrieben – auf absehbare Zeit schlecht verfügbar; eingeschränkte Empfehlung
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungen in einzelnen Gemeindeteilen?
Die Entscheidungen in den einzelnen Gemeindeteilen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ein zentraler Aspekt ist die Art, das Alter und die Dichte der bestehenden Bebauung, da diese bestimmt, welche Maßnahmen überhaupt technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll sind. Gerade im denkmalgeschützten Bereich sind zudem auch rechtliche Einschränkungen bezüglich der Gestaltung gegeben. Geplante Neubauten, Quartiere oder Rückbauvorhaben spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie oft mit neuen Anforderungen an die energetischen Standards verbunden sind. Gleichzeitig sind aber auch lokal nutzbare Wärmequellen, wie zum Beispiel Geothermie oder Abwärme, von Bedeutung.
Welche erneuerbaren Potenziale stehen zur Verfügung?
Das Potenzial erneuerbarer Energie- und Wärmeerzeugung ist unterschiedlich je nach den regionalen Gegebenheiten. Viele Gebäude bieten die Möglichkeit, Photovoltaik- und / oder Solarthermieanlagen zu installieren. Ebenso besteht die Option, Geothermie unter freien oder genutzten Flächen wie Parkflächen oder landwirtschaftlichen Gebieten zu nutzen. In manchen Wohngebieten kann auch Flusswasser als Wärmequelle herangezogen werden. Darüber hinaus lässt sich Wärme aus Abwassersystemen und unvermeidbarer Abwärme gewinnen. Wo andere Quellen nicht verfügbar sind kann z.B. meist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung von Außenluft installiert werden.
Was haben die Bürgerinnen und Bürger davon?
Die Wärmewende erfordert bis 2045 enorme Anstrengungen zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Deshalb ist der Austausch von fossil betriebenen Heizungsanlagen unumgänglich. Genaue Betrachtungen zeigen den Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern, welche Optionen zur klimaneutralen Wärmeversorgung an Ihrem Standort zu Verfügung stehen. So erfolgt ein transparentes Erwartungsmanagement und persönliche Planungen können bestmöglich informiert stattfinden.
Wie können Bürgerinnen und Bürger in die kommunale Wärmeplanung einbezogen werden?
Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Bestandteil der Wärmeplanung um alle Bedürfnisse und Meinungen zu berücksichtigen. Die Gemeinde Leiblfing wird ihre Bürgerinnen und Bürger durch Veröffentlichungen auf ihren bekannten Kommunikationskanälen (Homepage, MUNI App, Aushänge) sowie über Veranstaltungen einbeziehen. Zum Stand der Planungen und für Einblicke in die laufende Arbeit der prosio engineering GmbH folgen regelmäßige Informationen. Das Klimaschutzmanagement der Gemeinde Leiblfing ist bis auf Weiteres für sonstige Fragen erreichbar.
Steht mit Abschluss der kommunalen Wärmeplanung fest, in welchen Straßen ein Wärmenetz verlegt wird und wann sich die Bürgerinnen und Bürger anschließen können?
Die kommunale Wärmeplanung als strategische Planung legt zunächst nur die Gebiete fest, in welchen Wärmenetze alleine aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Chance auf Umsetzung besitzen. Eine positive Bewertung bedeutet nicht zwangsweise, dass tatsächlich ein Wärmenetz entsteht. Wird eine grundsätzliche Eignung eines bestimmten Gebietes festgestellt, so müssen zunächst zusätzliche Analysen (sogenannte Machbarkeitsstudien) erfolgen. Somit können nach der kommunalen Wärmeplanung vor allem ungeeignete Gebiete mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Durchführung von Machbarkeitsstudien für die weitere Planung von Wärmenetzen wird noch weitere Zeit in Anspruch nehmen, wobei das Ergebnis ausdrücklich offenbleibt.
Wird das Gasnetz auf Wasserstoff umgestellt und können damit Wohngebäude beheizt werden?
In wissenschaftlichen Studien besteht Einigkeit, das Wasserstoff in absehbarer Zeit nicht in ausreichender Menge als Energieträger für die Wärmebereitstellung von Wohngebäuden zur Verfügung stehen wird. Zudem werden Preise vorhergesagt, die deutlich höher liegen werden als derzeitige Erdgaspreise. Es ist davon auszugehen, dass Wasserstoff zunächst vor allem für die Versorgung industrieller Produktionsprozesse (z.B. Stahl, Düngemittel) eingesetzt wird. Aus diesem Grund kann aus heutiger Sicht nicht davon ausgegangen werden, dass auf absehbare Zeit eine flächendeckende Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff erfolgen wird.
Ist es ratsam, bestehende Öl- oder Gasheizungen zeitnah auszutauschen?
Das Heizen mit Erdöl und Erdgas wird in den kommenden Jahren mit steigenden CO2-Preisen und schwieriger geopolitischer Versorgungslage deutlich kostenintensiver werden. In Verbindung mit dem unsicheren Ausbau der Wasserstoffwirtschaft und der Transformation der Erdgasnetze ist daher von weiteren Investitionen in fossil betrieben Wärmeerzeuger abzuraten. Im Gegenteil – in einigen Kommunen erfolgt bereits eine teilweise Stilllegung des Gasnetzes. Außerdem wird der Umstieg auf erneuerbare Energien aktuell stark gefördert und es gibt teilweise zusätzliche Vorteile für einen schnellen Umstieg (z.B. „Klimageschwindigkeitsbonus“). Unter folgendem Link wurden mehr Informationen dazu bereitgestellt: Förderprogramme.
Welche Technologie ist zukunftssicher?
Die höchste Planungssicherheit besteht derzeit bei der Installation einer Wärmepumpe in Verbindung mit einer eigenen PV-Anlage zur Reduktion des Strombezugs aus dem öffentlichen Stromnetz.
Kann ein Altbau mit einer Wärmepumpe beheizt werden?
Nahezu jedes Wohngebäude ist mit einer Wärmepumpe des aktuellen Stands der Technik beheizbar. Die technische und wirtschaftliche Auslegung auch hinsichtlich weiter Modernisierungsmaßnahmen (Heizkörpertausch, Wärmedämmung) ist allerdings deutlich komplexer als die Installation klassischer Gas- und Ölfeuerungen. Eine seriöse Beratung ist an dieser Stelle zwingend erforderlich. Beispielsweise kann das Angebot der Verbraucherzentrale Bayern eine erste Einschätzung ermöglichen – weiterführende Informationen sind hier verfügbar: Energieberatung.
Förderprojekt
Die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans ist sowohl eine konkrete Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Leiblfing (hier auffindbar: Klimaschutzkonzept) als auch gesetzlich verpflichtend. Das Projekt wird über die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert. Die Projektträgerschaft wird von der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH übernommen.
Förderkennzeichen: 67K26999
Thema: „KSI: Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Leiblfing“
Projektlaufzeit: 01.07.2024 – 31.03.2026
Nationale Klimaschutzinitiative
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE): https://www.bmwk.de
Nationale Klimaschutzinitiative (NKI): https://www.klimaschutz.de
Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH: https://www.z-u-g.org/


